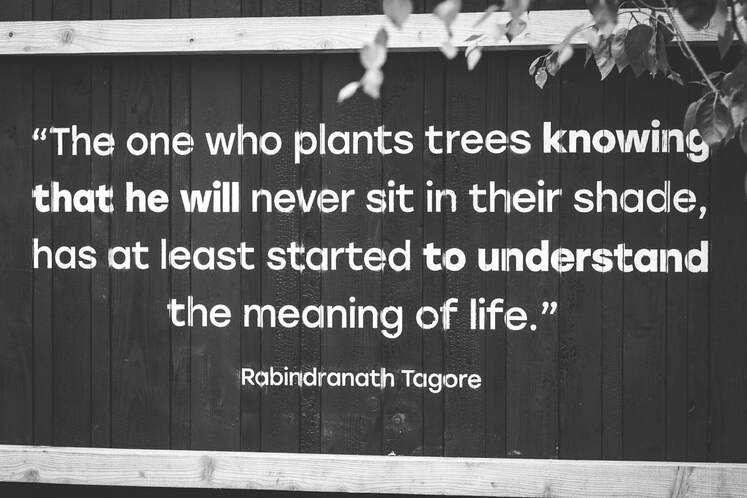|
Bild: Charlie Firth Eine gute Kultur ist wichtig. Sie entscheidet über die erfolgreiche Umsetzung von Strategien und damit über den langfristigen Erfolg. Es geht dabei um viel mehr, als um das Wohlbefinden der Mitarbeiter.
Kultur ist nicht Teil des Spiels, sie ist das Spiel. Sie wirkt auf alle Elemente und Ebenen der Organisation, ihre Strukturen und Prozesse und diese beeinflussen wiederum die Kultur. Was aber, wenn sie nicht passt, wenn sich z.B. Risikoscheu, Misstrauen oder "Engsichtigkeit" eingeschlichen haben? Die Veränderung einer Organisationskultur ist eine komplexe Angelegenheit, die langen Atem erfordert. Es gibt kein Rezept, kein linearer Pfad führt zum Ziel. Mit Rückschlägen ist zu rechnen. Das nicht zu erwarten und zu früh aufzugeben, ist fatal. Jede Organisation ist einzigartig und braucht für die Veränderung ihrer Kultur eine spezifische Architektur und passgenaue Interventionen. Kulturveränderung ist anspruchsvoll, weil sie alles betrifft und doch so wenig greifbar ist, weil sie an den Grundfesten rührt und daher besonders riskant erscheint. Kann man Kultur überhaupt gestalten? Sie verändert sich ja ohnehin laufend. Die Metapher eines Gartens finde ich besonders hilfreich. Den kann man nicht bauen, wie ein Haus. Auch er verändert sich ständig. Man braucht andere Fähigkeiten, als ein Baumeister. Die wichtigsten sind, die Geschicklichkeit und Behutsamkeit im Umgang mit Pflanzen. Welche Umgebung, welche Nahrung brauchen sie um zu gedeihen? Ähnlich ist es bei Kultur. Welchen Rahmen und welche Ressourcen brauchen die Leute, um ihnen eine angestrebte Änderung zu erleichtern? Wie kann man die Barrieren für Wachstum entfernen oder verringern? Vieles ist zu beachten. Auf Einges kann man jedenfalls nicht verzichten. Hier sind sechs essentielle Faktoren für das Gelingen eines Wandels: 1. Klarheit über das WOZU der Kulturveränderung und wie diese die STRATEGIE unterstützen soll Auch wenn es um Kultur geht, gibt es Modeerscheinungen. Manche Organisationen wollen sich eine neue Kultur verpassen, wie ein neues Outfit. Naturgemäß bleibt diese dann auch dort, an der Oberfläche. Will man mehr, dann ist ein gemeinsames Verständnis von Kultur und wozu deren Veränderung dienen soll, unverzichtbar. Dabei ist es wichtig, konkret zu zeigen, wie die Kulturveränderung zur Erreichung strategischer Ziele beitragen soll. Kulturveränderung ist ein Business-Projekt und nicht nur ein HR-Projekt. HR kann einen wichtigen Beitrag leisten und den Wandel unterstützen, nicht aber die Verantwortung übernehmen. Die liegt in den Geschäftsbereichen. Die Verbindung mit der Strategie muss klar und nachvollziehbar sein. Ebenso wichtig ist es, klare und messbare Resultate festzulegen. Wie soll sonst ein Fortschritt beurteilt werden? Auch wenn Kulturelemente selbst oft schwierig zu messen sind, kann die Wirkung von neuen Verhaltensweisen sehr wohl beurteil werden. Wenn keine konkrete Verbindung zwischen der Kultur und der Performance der Organisation hergestellt wird, wird die Verantwortung zur Kulturveränderung zu einer individuellen Angelegenheit statt sie als organisationales Vorhaben zu verstehen und verliert so schnell an Priorität. 2. Fokus auf WENIGE Kulturelemente und SPEZIFISCH auf die Organisation zugeschnitten Kulturentwicklungsprogramme lesen sich häufig wie eine Wunschliste mit Eigenschaften, die attraktive Unternehmen aktuell haben sollen. Die Begriffe sind abstrakt und austauschbar. Es ist eine weitverbreitete Fallgrube, den Versuch zu unternehmen, die Kultur erfolgreicher Unternehmen nachzuahmen. Die Folge? Keiner kennt sich mehr aus, nichts passt zusammen. Dieses Vorgehen ist das Gegenteil von strategischem Agieren. Da geht es um Differenzierung und eine bewusste Auswahl bei begrenzten Ressourcen. Dies gilt auch für die Kultur. Alles sein zu wollen ist nicht nur unmöglich, sondern bringt auch nicht den erhofften Erfolg. Es erinnert an Lokale, die umfangreiche Speisekarten anbieten und wo dann alles ein wenig "schal" schmeckt. Am Anfang steht daher die kluge Wahl. Welcher Aspekt der Kultur ist der größte Treiber für den Erfolg? Idealerweise beginnt man mit einem Element, das man verändern möchte. Wenn ein gewisses Momentum erreicht ist, kann man dann nachlegen und wenige weitere aufnehmen. Wie bei Verhaltens- und Einstellungsänderungen auf individueller Ebene sind es kleine Schritte, die den Erfolg bringen. 3. Kommunikation und VORLEBEN des Management-Commitments und Klärung der Rollen und Verantwortungen für den Wandel Wie die Mitglieder des Managements über die angestrebte Kulturveränderung reden und sich selbst verhalten ist möglicherweise das Wichtigste. Häufig wird die Rolle des Top Managements darin gesehen, die anzustrebende Kultur zu definieren und dann zu verkünden. Das ist nicht nur unzureichend, sondern kann die Lage tatsächlich verschlechtern. Auch Top-Manager sind Teil der Veränderung nicht nur als Gestaltende, sondern auch als Betroffene. „Die anderen sollen sich ändern, wir leben den Idealzustand schon.“ ist eine unglückliche Haltung und unterwandert die Glaubwürdigkeit des Vorhabens. Die Reflexion und Anpassung des eigenen Verhaltens sind daher von größter Bedeutung. Unterbleibt dies, führt es zu Vertrauensverlust in das Management und zu Zynismus in der Organisation. Bevor man also eine Kulturveränderung ankündigt, sollte man daher seine eigene Bereitschaft zur Verhaltensänderung überprüfen oder es sonst lieber bleiben lassen. 4. KONTEXT und MUSTER beachten, nicht nur individuelle Verhaltensweisen Kulturveränderungen zielen häufig auf individuelle Einstellungen und Verhaltensweisen ab. Das ist zu wenig und führt nicht zur gewünschten Entwicklung. Menschen nehmen in Organisationen verschieden Rollen ein. Mit diesen verbinden sie selbst und andere Erwartungen. Die Gestaltung dieser Rollen erfolgt immer relational, in Beziehung zu anderen. Einstellungen und Verhaltensweisen entwickeln sich in Abhängigkeit von anderen und können meist auch nur gemeinsam geändert werden. Der Trick an der Sache ist, dass diese gegenseitigen Abhängigkeiten oft nicht bewusst sind. So ist das Identifizieren dieser Muster ein wichtiger Schritt, der einige Erfahrung mit Kulturentwicklung erfordert. Auch die Anpassung von Kontextfaktoren, wie die Rekrutierungs- und Entwicklungsprozesse, das Performance-Management, die Struktur selbst oder die Raumgestaltung leistet einen wesentlichen Beitrag. 5. Einbeziehen von FREIWILLIGEN aus ALLEN Bereichen und auf allen Ebenen um die Übernahme von VERANTWORTUNG zu stärken Wann haben sie sich das letzte Mal geändert, weil es ihnen jemand gesagt hat? Das ist wohl lange her, wenn es überhaupt jemandem gelungen ist. Wir ändern unsere Ansicht und unser Verhalten, weil wir zur Einsicht gekommen sind, dass es anders nicht weiter geht oder besser wird, nicht weil es uns jemand sagt. Natürlich kann man mit Zwang arbeiten, mit Belohnung und Bestrafung. Kurzfristig ist das der einfachste Weg. Die Leute machen dann genau das was man beobachtet und sind sehr kreativ, dass System auszutricksen. Schade um diese Energie. Viel aussichtsreicher ist es, Menschen einzuladen, die neugierig sind und Freude an Veränderung haben. Sie sind es, die auch bereit sind, Neues auszuprobieren und Risiken einzugehen. Wenn sie zeigen, dass der neue Weg funktioniert und dem alten jetzt und in Zukunft überlegen ist, werden die anderen folgen. Die Veränderungskraft entwickelt sich so an vielen Stellen in der Organisation, in unterschiedlichsten Funktionen und auf allen Ebenen. Das Vertrauen steigt, wenn die Leute sehen, dass auch eine/r von ihnen den neuen Weg erfolgreich geht. Erfolgreiche Kulturveränderung wird geführt, von formellen und informellen Führungskräften, die Verantwortung übernehmen und so die Zukunft gestalten. 6. Wertschätzung der Stärken der BESTEHENDEN Kultur und KONSEQUENT dranbleiben Wenn über Kulturveränderung gesprochen wird, fühlen sich Leute, die schon länger dabei sind, oft verraten. Das Bestehende wird im besten Fall ignoriert oder sogar abgewertet. Vieles für das diese Leute sich eingesetzt haben, die Extrameile gegangen sind, ist nichts mehr wert. Sie kriegen in der Veränderungseuphorie keine Aufmerksamkeit. Ein großer Fehler. Denn natürlich sollen Dinge auch gleich bleiben und aus gutem Grund bewahrt werden. Gruppen und Organisationen entwickeln eine Identität, wie Menschen auch. Auch wenn sie sich weiterentwickeln, wollen sie „sie selbst bleiben“ und sich nicht völlig auflösen. Gerade für die, die schon länger in der Organisation sind, ist dies oft wichtig. Sie wollen erleben, dass sich ihre Mühen gelohnt haben und nach wie vor als wichtig und richtig angesehen werden. Wie bei Neujahrsvorsätzen besteht auch die Gefahr nach den ersten Erfolgen den „Sieg“ auszurufen. Diesem trügerischen Eindruck zu folgen ist gefährlich. Denn das Risiko ist groß, früher oder später wieder in die alten Muster zu fallen. Es braucht langen Atem, Disziplin und Training bis die neuen Denk- und Verhaltensweisen eingeübt werden und nach gegebener Zeit zur Gewohnheit, zur neuen Kultur werden. Wir leben in einer Zeit des Umbruchs auf vielen Ebenen. Annahmen und Verhaltensweisen, die uns bisher erfolgreich gemacht haben, gelten oft nicht mehr. Viele Entwicklungen finden parallel mit einer bisher nicht erlebten Geschwindigkeit statt. Die relevanten zu antizipieren und sich entsprechend anzupassen ist große Führungskunst. Diese kann nicht mehr von einem kleinen, benannten Kreis in der Organisation realisiert werden, sondern braucht die Intelligenz und Kraft an vielen Stellen in der Organisation. Bild: Jan Babor Nach zwölf Monaten milder und harter Lock-Downs sind viele Mitarbeiter nach wie vor im Home-Office und haben sich so weit in der neuen Art des Arbeitens eingerichtet. Anfangs war das auch bei vielen sehr willkommen. Man erspart sich die lästige Fahrzeit ins Büro und kann sich seinen Arbeitsplatz nach seinen Bedürfnissen einrichten.
Mit der Zeit wurde das allerdings alles etwas mühsam. Das eingefrorene soziale Leben, die Arbeit nur von zu Hause und die Beschränkung auf virtuelle Kommunikation erzeugt eine eigenartig gedämpfte Stimmung. Sie ermüdet und lässt alle Tage gleich erscheinen. Trotz vieler virtueller Meetings fühlen sich die Leute mehr und mehr isoliert. Diese anhaltend, unerfreuliche Lage stellt Führungskräfte daher vor die Herausforderung, die Energie und Motivation ihrer Mitarbeiter hochzuhalten. Natürlich ist jeder in erster Linie selbst dafür verantwortlich, mit der Lage zurechtzukommen, sich selbst zu motivieren. Führungskräfte können allerdings einen Rahmen schaffen, wo dies leichter gelingt. Hier sind vier Tipps, wie Sie den größten Herausforderungen begegnen können: 1. Struktur und Freiraum geben
2. Kommunikation und Kooperation erleichtern
3. Respekt und Grenzen zeigen
4. Isolation und Einsamkeit verhindern
Diese Empfehlungen erscheinen naheliegend und selbstverständlich. Dies ist allerdings nicht der Fall. Einiges wurde in den ersten Monaten begonnen und ist nach und nach wieder eingeschlafen. Es ist gar nicht so leicht einen neuen Modus einzuüben, wo man sich nicht regelmäßig persönlich sieht oder eben einmal in der Kaffeeküche austauschen kann. Diese Rahmenbedingen werden uns allerdings noch länger begleiten und daher lohnt es sich, dranzubleiben. Der Gewinn ist, dass nicht nur ihre Mitarbeiter mehr Freude an der Arbeit haben, sondern auch sie selbst. Bild: Robert Collins Sind die Leute produktiver oder nicht, wenn sie von zu Hause arbeiten? Nach einem Jahr der Pandemie und weitgehendem Home-Office gehen die Meinungen auseinander. Die einen meinen, dass die Leistung leidet, weil die Menschen abgelenkt sind und weniger kontrolliert werden. Die anderen sehen es umgekehrt. Sie können nach ihrem eigenen Rhythmus und konzentrierter arbeiten.
Eins setzt virtuelles Arbeiten jedenfalls voraus: mehr Vertrauen. Ohne Vertrauen könnten wir unseren Alltag nicht bestreiten. Es ist die Grundlage für Kooperation und wichtiges Element jeder Organisation. Doch steht es mit dem Vertrauen in Organisationen oft nicht zum Besten. Noch immer meinen Manager, dass die Mitarbeiter ihr Vertrauen erst verdienen müssen. Sie geben keinen Vertrauensvorschuss und häufig herrscht eine Kultur des Mikromanagements. Manchmal fühlen sich Mitarbeiter sogar überwacht. Das hat seinen Preis. Wenn das Vertrauen niedrig ist, bezahlt man eine versteckte "Steuer" für jede Transaktion, jede Kommunikation, Interaktion und Entscheidung . Alles wird langsamer, komplizierter und teurer. Vertrauen führt zu mehr Vertrauen. Nach Luhmann ist Vertrauen ein „Mechanismus zur Reduktion sozialer Komplexität“. Das Mittel der Wahl gegen Orientierungslosigkeit und Veränderungsangst. "Wer vertraut, trifft eine Art Vorentscheidung. Vertrauen ist das Zutrauen zu eigenen Erwartungen." Tatsächlich erleben die meisten Menschen eine größere Verbindlichkeit, wenn Ihnen Vertrauen entgegengebracht wird. Ist das nicht der Fall, werden oft Energien frei, um Kontrollen zu umgehen. Es entsteht eine knausrige Haltung. Man tut genau das und so viel, wie man unbedingt muss – also Dienst nach Vorschrift. Manager wünschen sich das natürlich nicht. Sie wollen engagierte Mitarbeiter, die im besten Sinne zum Unternehmenserfolg beitragen. Und das gelingt nur mit Vertrauen. Nicht nur die Vertrauenswürdigkeit der Menschen steigt, wenn ihnen Vertrauen entgegengebracht wird, sondern auch ihr Selbstvertrauen. Der Pygmalion Effekt beschreibt das Ergebnis von verschiedenen Studien, die zeigen, dass die Leistungsfähigkeit von Menschen steigt, wenn man ihnen mehr zutraut und damit auch mehr vertraut. Dabei geht es nicht um Vertrauen oder nicht. Es geht nicht um blindes Vertrauen. Vertrauen ist immer relativ und spezifisch. In bestimmten Situationen vertraut man bestimmten Personen in einer konkreten Angelegenheit. Das ist wichtig, denn…. …Vertrauen ist immer ein Risikoangebot. Wer es hat, leistet einen Vorschuss an Optimismus. Wer Sicherheit sucht, findet so etwas unangenehm. Bei Überraschungen und Neuerungen, wo es wichtig ist, sich schnell zu verändern, gelingt dies leichter, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, denen man vertraut. Vertrauen ermöglicht Entscheiden in Situationen, in denen nicht alles recherchiert und kalkuliert werden kann. An die Stelle von Wissen treten Erwartungen bezogen auf etwas, das in der Zukunft liegt. Vertrauen hat zwei Seiten, derjenige, der Vertrauen gibt und derjenige, der sich als vertrauenswürdig erweist. Ob jemand vertrauenswürdig erscheint, lässt sich aus nachstehender Formel ableiten. Vertrauen= Kompetenz+ Zuverlässigkeit+ Wohlwollen Mit Kompetenz ist die Fähigkeit gemeint, das anvertraute persönlich und inhaltlich zu erfüllen. Es hat mit Wissen, Erfahrung und Charakterstärke zu tun. Kompetenz bedeutet die Fähigkeit, in einer bestimmten Situation die Verantwortung übernehmen zu können. Konsistenz beschreibt die Zuverlässigkeit, die Integrität - wie kongruent Worte und Taten sind. Wohlwollen heißt, dass der Vertrauenswürdige es gut mit mir meint, er meine Interessen unterstützt, dass ich meine Schwächen zeigen kann. Wenn Kompetenz oder Konsistenz nicht zufriedenstellend sind, kann es noch gelingen das Vertrauen wieder herzustellen. Fehlt das Wohlwollen, ist es kaum noch möglich. Das wichtigste Element, sich als vertrauenswürdig herauszustellen ist demnach, nicht nur Eigeninteressen auf Kosten anderer zu verfolgen. Wie Kant es in seinem kategorischen Imperativ formulierte. „Der Mensch existiert als Zweck an sich selbst, nicht bloß als Mittel zu beliebigem Gebrauche“. Das Gegenteil von Vertrauen ist nicht Kontrolle. Das Gegenteil ist Misstrauen. Kontrolle kann oft sehr hilfreich sein, denn Menschen brauchen Feed-Back. Wenn dieses ausbleibt oder zu rar ist, erscheint die Arbeit bald sinnlos. Die Bemühungen verschwinden in ein „schwarzes Loch“ und damit erstickt jede Motivation. Nicht Kontrolle an sich mindert das Vertrauen, sondern das Motiv dahinter. Kontrolle und Feedback sollen helfen, festzustellen, ob man am richtigen Weg ist. Das kann in vielen Fällen Selbstkontrolle sein. Oft hilft aber die Rückmeldung oder der Antrieb von jemand anderem. Diese sind willkommen, wenn sie dem Gegenüber tatsächlich helfen, besser zu werden und dranzubleiben. Vertrauen ist ein kritisches Element wirksamer Führung. Vertrauen zu geben und zu erhalten, erleichtert mit den Ungewissheiten besser umzugehen. Das Ziel dabei ist, so weit wie möglich zu vertrauen und seine eigene Vertrauenswürdigkeit auszubauen. Vertrauen entsteht durch Handlungen, nicht durch Worte -"Vertraue mir" lässt Menschen eher vorsichtig werden. Ihre eigene Vertrauenswürdigkeit können Führungskräfte stärken, indem sie Gute Beziehungen aufbauen
Fachkompetenz zeigen
Konsistenz zeigen
Diese drei Elemente sollten idealerweise im Einklang stehen, wobei das erste den stärksten Einfluss hat. Mehr Vertrauen geben Anderen Vertrauen zu geben hat oft mit dem Vertrauen in sich selbst und den eigenen Fähigkeiten zu tun. Die Bereitschaft zu vertrauen ist umso höher, je höher das eigene Selbstvertrauen ist. Wer sich selbst vertraut, geht gelassener durch die Welt. Es fällt leichter, anderen „Gutes“ zu unterstellen und vertrauensvoll auf sie zuzugehen. Selbstbewusste Menschen können sich eine Enttäuschung auch eher leisten. Das hat nichts mit Leichtgläubigkeit zu tun. Zudem zeigen Studien, dass man nicht öfter ausgenutzt wird, wenn man vertraut. Im Gegenteil, es gibt Belege dafür, dass dem, der vertraut auch eher Vertrauen entgegengebracht wird. Wer anderen misstraut, wird dafür häufiger enttäuscht und sieht sich mit seinem Misstrauen bestätigt. Welche Überzeugung man auch hat, sie bewahrheitet sich. “Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“. Ob man anderen vertraut, hängt also oft mehr mit einem selbst zusammen als mit den anderen. Vertrauen geht davon aus, dass der andere meine Interessen verfolgen und meine Erwartungen erfüllen wird. Es unterstellt der anderen Person gute Absichten. Dennoch ist es sinnvoll die Risiken abzuschätzen und zu eruieren, ob der andere unser Vertrauen verdient. Natürlich kann unser Vertrauen missbraucht werden. Wenn wir die Möglichkeit haben, teilen wir dem anderen unsere Enttäuschung und Erwartungen mit. Verhält sich der andere weiterhin in dieser Weise, distanzieren wir uns am besten von ihm. Die Fähigkeit vertrauen zu können ist wichtig für unsere Beziehungen und für unser Wohlbefinden. Können wir nicht vertrauen, müssen wir ständig auf der Hut sein, ausgenutzt und benachteiligt zu werden. Wir verspüren den ständigen Impuls alles kontrollieren zu müssen. Das ist nicht nur unmöglich, sondern auch ungesund. März 2020. Am Anfang fühlte ich mich wie in einem Katastrophen-Film. Zuerst kam die Nachricht, dass die Gastronomie abends schließen muss. Zwei Tage später folgte, dass das auch für alle Geschäfte bis auf die lebensnotwendigen gilt.
Der erste Schock. Donnerstagnachmittags, geräumte Regale in allen Lebensmittelgeschäften. Leute begannen zu horten, was das Zeug hält. Sollte ich jetzt auch sicherheitshalber einkaufen? Wie lange reichen die Vorräte? Die letzten Nudeln und Dosen landeten in meinem Einkaufskorb. Der erste Lockdown brachte die besten und schlechtesten Seiten der Menschen zum Vorschein. Eine Welle von Solidarität sorgte für die Unterstützung der Schwächsten. Allerdings folgt auch gleich die erste Kündigungswelle, trotz des Angebots zur Kurzarbeit. Die Börsen brachen ein und die Sorge war groß. So schlimm, wie befürchtet, kam es dann vorerst doch nicht. Erleichterung erlebten wir dann im Sommer und tatsächlich auch ein paar fast normale Ferientage. Und dann im Herbst der Rückschlag. Einem leichten Lockdown folgte der harte, dann kurze Erleichterung und wieder retour zum harten Lockdown. Diese abrupten Änderungen, die Ungewissheit, die Herausforderungen durch Home-Office und Kinderbetreuung bei gleichzeitig gefühlter Isoliertheit trafen auf Menschen, die oft schon davor chronischem Stress ausgesetzt waren. Die Basis für Burnout wurde lange vor der Pandemie gelegt. Sie ist nur ein Verstärker. Es ist daher nicht überraschend, dass die psychischen Auswirkungen der Pandemie der Gefahr durch das Virus um nichts nachstehen. Niemand konnte das Ausmaß der Pandemie voraussehen. Dies ist verständlich. Aber als es absehbar wurde, dass diese Situation länger dauern würde, hätten wir unsere Arbeitsweise überprüfen können. Wir hätten überlegen können, wie wir jene Praktiken vermeiden, die Burnout fördern. Das Gegenteil war der Fall, die Dinge wurden in vielen Fällen schlechter. Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmt. Häufig wird mehr Einsatz erbracht oder schlichtweg erwartet, weil man ohnehin zu Hause ist. Gerade den Engagierten fällt es schwer, Grenzen zu setzen. Die eingesparte Fahrzeit wird einfach „aufgefüllt“. Eine Flut von Meetings füllt den Kalender, oft ohne Pausen mit ungesund langer Bildschirmzeit. Neben der Arbeit übernehmen viele auch die Kinderbetreuung und Hausunterricht. Wie erschwerend die Umstände für viele sind, stößt auf wenig Verständnis. Man trifft die Leute ja auch kaum und in den virtuellen Meetings kommt der persönliche Austausch oft zu kurz. Erschöpft, ist das alleine mein Problem? Christina Maslach, University of California, Susan E. Jackson of Rutgers, und Michael Leiter of Deakin University sprechen von Burnout, wenn drei Symptome zusammenkommen:
Sie haben folgende sechs Hauptursachen für Burnout identifiziert.
Trotz dieser Erkenntnis, dass viele Ursachen von Burnout in der Organisation liegen, ist seine Behandlung zumeist eine individuelle Angelegenheit. Man bekommt höchstens Tipps, wie es z.B. mit Yoga oder Meditation zu probieren. Entspannung ist sicher gut für das Wohlbefinden. Für Burnout ist sie alleine nicht effektiv. Dabei haben gerade die Jüngeren, die Millenials das größte Risiko für Burnout. Oft erleben sie weniger Autonomie bei der Arbeit, größeren finanziellen Druck und das Gefühl von Einsamkeit. Dabei ist der letzte der gravierendste Faktor . Die Bedeutung von psychologischer Sicherheit Amy Edmonson, Professorin an der Harvard Business School versteht unter psychologischer Sicherheit „a shared belief held by member of a team, that the team is safe for interpersonal risktaking“, also ein Klima, in dem sich Leute frei fühlen, ihre Meinung sagen, nach Hilfe zu fragen oder eine Idee einzubringen. In so einem Klima wird Burnout unwahrscheinlicher. Wir fühlen uns wohler und können unsere beste Leistung erbringen, wenn wir nicht taktieren müssen, wenn wir einfach wir selbst sein können. Was können also Führungskräfte tun, um psychologische Sicherheit zu erhöhen.
Oft gehen Führungskräfte davon aus, dass es ihre Aufgabe ist, andere zu bewerten. Tatsächlich ist ihre primäre Aufgabe, andere zu befähigen, indem sie Rahmenbedingungen schaffen, wo Mitarbeiter leicht und gut zum Gesamtergebnis beitragen können. Neben der psychologischen Sicherheit ist es auch wichtig für ein angemessenes Arbeitspensum zu sorgen. Große Zeitfresser sind oft Meetings und es lohnt sich, jede einzelne zu überprüfen. Ist dieses Meeting notwendig? Wenn ja, brauchen wir länger als 30 min? Wer muss wirklich dabei sein oder kann man Informationen im Nachgang zur Verfügung stellen? Wichtig ist es auch, Empathie zu zeigen und Mitarbeitern zu ermöglichen, über ihr Befinden bei der Arbeit sprechen zu können. Auch bei einem kurzen Meeting, lohnt sich eine Einstiegsfrage danach, wie es den Leuten geht. Wie steht es mit meiner Resilienz? Oft geht es Führungskräften allerdings auch nicht besser als ihren Mitarbeitern. Die Belastungen haben infolge der Coronakrise stark zugenommen. Auch wenn sie Stress in der Regel gewohnt sind, sind viele an Ihre Belastungsgrenze geraten. Was können Sie für sich selbst tun?
Wenn Laurence Fink, Vorsitzender des weltgrößten Vermögensverwalters in einem Brief an die CEOs seiner investierten Firmen schreibt, dass ihre Unternehmen einem „Purpose“ dienen sollen, sollte man spätestens hellhörig werden. Möglicherweise versteckte sich mehr als eine neue Managementmode dahinter.
Was ist ein Purpose? Die einfache Übersetzung mit dem Wort Zweck greift etwas zu kurz. Der Purpose beantwortet die Frage, WARUM eine Organisation das tut, was sie tut, welchen Sinn das Ganze hat. Der Anspruch ist, nicht nur Eigennutz und finanzielle oder Wettbewerbs-Ziele zu verfolgen, sondern einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Dabei meint er mehr als die seit rund zwei Jahrzehnten verfolgte Corporate Social Responsibility. Diese hat sich im Wesentlichen auf das Sponsoring von wohltätige Aktivitäten und damit verbundener positiver PR konzentriert. Der Purpose unterscheidet sich auch von einem Mission-Statement. Dieses beantwortet die Frage nach dem „WAS “ . Der Purpose wiederum beleuchtet den dahinterliegenden Sinn, die beabsichtigte Wirkung. Wofür einen Purpose? Wieso ist das jetzt wichtig? Die Forderung nach einem Purpose kann als Gegenbewegung an das Streben nach Gewinnmaximierung verstanden werden. Diesen Auftrag, den Milton Friedman schon in den sechziger Jahren gestellt hat, haben insbesondere börsennotierte Unternehmen seit den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts weitverbreitet aufgenommen. Seine Aufforderung, Profite zu steigern, solange man sich im gesetzlichen Rahmen bewegt, hat auch eine Zeit lang auch gut funktioniert, Prosperität erzielt und Investoren zufrieden gestellt. Nach einigen Jahrzehnten zeigen sich die allerdings die bitteren Schattenseiten dieser eindimensionalen Wirtschaftsweise. Die Umweltschäden sind nicht mehr zu ignorieren und die verantwortungslose Ausbeutung von Tier und Mensch nicht mehr zu tolerieren. Weniger ist mehr An Adipositas sterben mittlerweile weltweit mehr Menschen als an Hunger. Die Berge an weggeworfenen Kleidungsstücken in den Kleidersammlungsstellen müssen entsorgt werden, weil sie keine Verwendung mehr finden. Unsere Behausungen sind gefüllt mit tausenden Dingen, Lagerraum-Anbieter boomen und wir kaufen immer Dinge, die wir kaum oder gar nicht nutzen. Es ist höchste Zeit, in größeren Zusammenhängen zu denken und zu verstehen, dass Absatzzahlen und Profitmargen nicht alleine zählen dürfen. Viele junge, gut ausgebildete Menschen haben das verstanden und suchen ein Wirkungsfeld, in dem sie etwas Positives bewirken können. Ihnen zu erzählen, dass das Ziel ist, die Nr. 1 zu sein, wird sie nicht mehr bewegen. Auch auf der Konsumentenseite tut sich etwas. Immer mehr Leute haben genug von der „Wegwerfgesellschaft“, beginnen bewusster, oft auch weniger zu konsumieren und achten mehr auf Nachhaltigkeit. Wie formuliert man einen Purpose? Der Purpose beantwortet die Fragen warum man macht, was man macht und wem die Organisation wie dient oder nutzt? Folgende Schritte können bei der Beantwortung helfen:
Die Antwort auf die letzte Frage soll Entscheidungen und Verhalten in der Organisation grundlegend leiten. Sie trägt damit auch dazu bei, sich in Richtung der angestrebten Vision zu bewegen. Daher ist es wichtig, dass die Formulierung so kurz wie möglich und so aussagekräftig wie nötig ist. Sie muss mehr als eine Produkt- oder Leistungsbeschreibung sein, darf aber auch nicht zur allgemeinen „Wir machen die Welt besser“ Floskel werden. Eine guter Purpose verbindet Wertversprechen und Werte. Er ist verbunden mit dem, was eine Organisation leisten kann und begründet auf dem, welche Wirkung man bei den Kunden, der Gesellschaft und den Mitarbeitern, also nicht nur bei den Investoren erzielt werden will. Eine spezifische Formulierung bringt allerdings das Dilemma mit sich, dass sich Dinge ändern und der Purpose möglicherweise nicht mehr passt. Auch wenn der Anspruch einer gewissen Dauerhaftigkeit besteht, ist es ein Irrtum, dass der Purpose für alle Zeit gleichbleiben muss. Es empfiehlt sich daher, den Purpose bei jeder Strategieänderung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. So weit, so schwer und wenn der Purpose endlich einem guten Statement mündet, ist dies erst der Beginn. Wie lebt man den Purpose? "The purpose of a system is what it does. There is, after all, no point in claiming that the purpose of a system is to do what it consistently fails to do." Stafford Beer Wenn Sie nicht gerade ein Unternehmen gründen, haben Sie es mit etablierten Routinen und dahinter liegenden Interessenslagen zu tun. Sollte der definierte Purpose ohnehin das beschreiben, was sie tun und bewirken, dann weiter so. Im anderen Fall bedeutet den Purpose zu leben einen Kulturwandel zu erreichen. Dieser beginnt bei den Aktivitäten und mündet in einer Veränderung der Glaubenssätze und Normen aller Beteiligten. Die größere Gefahr für die Wirksamkeit eines Purpose ist allerdings nicht, dass er nicht mehr passt, sondern dass er gar nicht zur Geltung kommt. Es bleibt beim Statement und die alltäglichen Dringlichkeiten führen dazu, dass man bei den etablierten Gewohnheiten bleibt. Wo soll man also beginnen? Für jede Tätigkeit in der Organisation ist die Frage zu beantworten „Wie trägt diese zu unserem Purpose bei“. Kann diese nicht positiv beantwortet werden, ist die Tätigkeit zu überdenken oder zu verwerfen. Es gibt natürlich auch Routinetätigkeiten, die unabhängig vom Purpose erledigt werden müssen. Sie sind nötig, dass man den Purpose überhaupt verfolgen kann. Entscheidungen bedeuten immer das Abwägen von Trade-Offs. Ein Purpose sollte allen in der Organisation helfen zu guten Entscheidungen zu kommen. Das wiederum setzt voraus, dass alle den Purpose kennen, verstehen und für sinnvoll erachten. Der Pupose wird von allen, oder zumindest den meisten angenommen, wenn dieser nachvollziehbar ist. Er wird umgesetzt, wenn in guten Dialogen ein gemeinsames Verständnis zum Zweck des Purpose entwickelt wird. Dem Management kommt dabei eine herausragende Rolle zu. Sein Verhalten dient als Maßstab für dir Glaubwürdigkeit des Vorhabens. Seine Mitglieder sind allerdings auch nur Menschen und sie weichen an der einen oder anderen Stelle von den Ambitionen ab. Sie brauchen daher einen guten Feedback-Mechanismus, der ihnen hilft, ihr Verhalten einzuschätzen und gegebenenfalls zu korrigieren. Die Verhaltensänderung kommt zuerst und macht eine Einstellungsänderung möglich und nicht umgekeht. Der oft umgekehrt begangene Weg ist wenig aussichtsreich. Um den Begriff Purpose ist in den letzten Jahren ein Hype entstanden, der wieder nach einer Modeerscheinung klingt. Um dabei zu sein „verpassen“ sich viele Unternehmen einen Purpose. Mit dem Statement alleine hat dies eine ähnliche Wirkung wie die von Leitbildern, Mission Statements und Visionen in der Vergangenheit, nämlich eine bescheidene. Wenn Sie es ernst meinen, sollten sie dem Vorhaben daher ausreichend Aufmerksamkeit und Zeit schenken, über eine Formulierung hinausgehen und mit konkreten Verhaltensänderungen starten. Dann sollte die Übung gelingen. In der aktuellen unsicheren und ungewissen Lage heißt Führen vor allem Entwicklung, Veränderung oder sogar eine Transformation voranzutreiben.
“Nothing is so painful to the human mind as a great and sudden change.” schreibt Mary Wollstonecraft Shelley. Wenige mögen Veränderung. Sie sind unbequem und manchmal bedrohlich. Auch wenn viele schon eine Reihe von Veränderungen erlebt haben, bleibt das Unbehagen. Oft verbreitet sich Veränderungsmüdigkeit, weil wieder eine Veränderung angekündigt wird, die nicht die angestrebte Wirkung erzielt. Neues zu wagen und die Zukunft zu gestalten braucht Mut, Zuversicht und Kompetenz. Der „technische“ Teil ist bei Veränderungen der Organisation oder Arbeitsweise meist der einfachere. Die größere Herausforderung liegt bei den Menschen. Wie kann man sie nicht nur dazu zu bringen, die neuen Techniken und Methoden umzusetzen, sondern auch, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und gut zusammenzuarbeiten? Der Schlüssel hierfür liegt in exzellenter Kommunikation. Sie hilft Informationslücken zu schließen und Gerüchte zu entkräften. Effektive Kommunikation stärkt den Teamgeist, weil jeder versteht, wie er zum gemeinsamen Ziel beiträgt und warum. Einfacher gesagt als getan. Wie gelingt also gute Kommunikation? Hier sind 7 Tipps 1. Frühzeitig, klar und oft Informieren Sie so früh und so konkret wie möglich über geplante Veränderungen.
2. Kommunikation durch die richtigen Personen Die Mitarbeiter wollen die Botschaft vom Initiator und von ihren Führungskräften hören. Eine Verkündung über E-Mail ist zu wenig. Sie brauchen jemanden, der persönlich mit ihnen kommuniziert. Details sind wichtig und werden am besten von jenen kommuniziert, die das Vertrauen der Leute besitzen. Wenn die Leute dem Botschafter nicht vertrauen, werden sie reflexartig gegen die Maßnahme sein. Daher ist es im Vorfeld so wichtig Vertrauen aufzubauen. Alle Führungskräfte müssen wissen, warum diese Veränderung durchgeführt wird, wie sie umgesetzt werden soll und wie die Mitarbeiter konkret betroffen sein werden. Verstärkt wird das Leadership Team idealerweise durch Leute von verschiedenen Funktionen, die die wichtigsten Botschaften in die Organisation tragen. 3. Kommunikation über vielfältige Kanäle Jeder hat einen unterschiedlichen Kommunikationsstil, daher ist es wichtig Medien zu variieren und einen guten Mix aus persönlichem Gespräch, E-Mails/Newsletter, Videos und Werkzeugen für die Zusammenarbeit zu kreieren. 4. Beantworte die Frage „Was bedeutet das für mich?“ „Was habe ich davon?“ Was den meisten Führungskräften bei der Kommunikation von Veränderungen schwerfällt, ist wirklich konkret zu werden. Vor allem die Antwort auf die Frage „Was habe ich persönlich davon?“ bleibt oft unbeantwortet. Es ist wichtig auf die individuellen Bedenken eingehen und den Mitarbeitern so genau wie möglich zu skizzieren, welche Konsequenzen die Veränderungen für Sie haben werden. 5. Auf Widerstand vorbereitet sein Ohne Widerstand gibt es keine Veränderung. Es ist wichtig, sich die Zeit nehmen, Widerstand systematisch zu analysieren und nicht auf Annahmen vertrauen, die auf vergangenen Erfahrungen beruhen. Alle Leute, die von der Veränderung betroffen sind, haben eine emotionale Reaktion, auch wenn die Veränderung positiv oder rational erscheint. Jedenfalls reagieren Menschen sehr unterschiedlich auf Veränderung. Die häufigsten Gründe für Widerstand sind
Vor Verkündung der Veränderung ist es also ratsam mögliche Bedenken zu überlegen und Reaktionen darauf vorzubereiten. 6. Auf Feed Back hören Gelungene Kommunikation geht in beide Richtungen. Feed Back gibt wertvolle Informationen nicht nur zur „Befindlichkeit“ der Mitarbeiter, sondern auch zu Dingen, die man möglicherweise übersehen hat. Auch hier kann man vielfältige Wege nutzen- Meetings, Online Chats oder Umfragen. „Pulse Checks“, kurze online-gestützte Umfragen helfen Hürden früh zu erkennen und geben Mitarbeitern die Möglichkeit, den Veränderungsprozess zu beeinflussen. Feed Back sind ein guter Weg, Akzeptanz und Engagement zu bekommen. Allerdings, nur wenn man offen ist, gegebenenfalls den ursprünglichen Plan zu ändern. 7. Botschaft wiederholen „Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht einverstanden, einverstanden ist nicht angewandt, angewandt ist noch lange nicht beibehalten.“ Konrad Lorenz‘ Zitat zeigt, dass es viel braucht, bis eine Botschaft „ankommt“. Tatsächlich behalten wir nur 10% von dem, was wir gelesen, 20% von dem, was wir gehört und 30% von dem, was wir gesehen haben, wenn es um neue Verhaltensweisen geht. Zumeist unterschätzen Führungskräfte, wie oft eine Wiederholung notwendig ist, um alle zu erreichen. Und eine simple Wiederholung ist bei weitem nicht so wirksam wie eine kluge Variation, die die Aufmerksamkeit der Leute bekommt. Das gelingt am besten, wenn man mit wirklichem Interesse gezielt auf Ihre Fragen und Bedenken eingeht. Damit ist es allerdings nicht getan Den größten Erfolg, nämlich 90% erzielt man, wenn Mitarbeiter die neuen Erfahrungen bereits gemacht haben. Kommunikation ist notwendig aber nicht hinreichend. Wenn Mitarbeiter nicht zusätzlich den Rahmen und die Unterstützung finden, die neuen Verfahren anzuwenden, versandet selbst die beste Kommunikation. Sie brauchen die Mittel, die Fähigkeiten und die Ermunterung durch ihre Führungskräfte. Dann kann es gelingen, dass sich allmählich eine Kultur einwickelt, in der Mitarbeiter Entwicklung nicht nur akzeptieren, sondern suchen und aktiv zur erfolgreichen Zukunft der Organisation beitragen. Alle reden von Kultur. Sie soll sich ändern zu mehr Agilität, Unternehmergeist, Kooperations- und Entscheidungsfreude. Es werden detaillierte Analysen, Umfragen, Fokusgruppen und Workshops durchgeführt, um kulturelle Handlungsfelder zu identifizieren. Das kann Monate dauern und bis die Ergebnisse vorliegen ist häufig die „die Luft ist raus“. Was oft bleibt sind reine Absichtserklärungen und Frust.
Schnell und einfach Geht das auch anders und effektiver? Was, wenn Veränderung spontan passieren würde? Es ist wesentlich einfacher einige, wenige Details zu verändern, als gleich ganze Glaubenssätze, Einstellungen und Verhaltensmuster. Kleine und unscheinbare Aspekte der Umgebung können eine substantielle Wirkung auf Entscheidungen haben. Verhaltensforscher meinen, dass wir berechenbar irrational sind. Und was berechenbar ist, kann zu einem gewissen Grad beeinflusst werden. Mit dem Einsatz von „Nudging“ kann Verhalten von Menschen beeinflusst werden, ohne sie zu beschränken. Sie werden durch kleine Stupser zu einem gewünschten Verhalten angeregt. Verhaltensänderungen lassen sich so durch die gezielte Gestaltung des Arbeitsumfelds in relativ kurzer Zeit erreichen, sofern dabei Verhaltens-wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch berücksichtigt werden. Dabei kommen weder Regeln, Vorschriften noch Verbote zum Einsatz, denn beim Nudging bleibt die Entscheidungsfreiheit jedes Einzelnen gewahrt. Es wird lediglich die Entscheidungssituation so gestaltet, dass es leichter fällt, sich für das gewünschte Verhalten zu entscheiden. Wichtig ist dabei, dass die Mitarbeiter ihre Wahlfreiheit behalten. Führend in diesem Bereich sind die großen Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley. An der US-Westküste besitzt systematisches Nudge Management schon länger eine große Bedeutung. Die Büros von Google und Co. sind so gestaltet, dass sie ständig Nudges an die Mitarbeiter senden. Das reicht bis in die Kantine hinein, in der kleine Teller dazu anregen, weniger zu essen. Gesundes Obst steht auf Griffhöhe, Süßigkeiten eher versteckt. Die vielversprechenden Ergebnisse veranlassten wohl auch Laszlo Bock, den ehemaligen Personalchef von Google 2018 mit einem „Nudge Engine“ auf den Markt zu gehen . Er verfolgt dabei die ehrgeizige Mission durch die Kombination von maschinellem Lernen und Verhaltensökonomie die Arbeit von allen überall besser zu machen. Nudging in der Praxis Erfolgsentscheidend ist der sorgfältig geplante Einsatz von Nudges. Dann können sie ein Treiber für Kulturwandel und Transformation sein. Die folgenden vier Grundprinzipien erhöhen die Wirksamkeit von Nudges
Nudges können zur Erhöhung der persönlichen Produktivität eingesetzt werden. Ein Beispiel ist Habitica, das Menschen dabei hilft, ihre Gewohnheiten im realen Leben zu verbessern. Es "gamifiziert" die Vorhaben, indem es alle Aufgaben in kleine Monster verwandelt, die man besiegen muss. Je besser man sich dabei anstellt, umso weiter kommt man. Auch Diversity Mangement kann von Nudges profitieren. Führung ist typischerweise männlich konnotiert. Wenn man sich mehr Frauen in Führungspositionen wünscht, ist die Präsentation von Beispielen erfolgreicher Frauen ein wirksamer Nudge um dieses Klischee zu überwinden. Nudges ergänzen die bestehenden Ansätze zur Weiterentwicklung der Organisationskultur. Wer den Kulturwandel beschleunigen will, sollte nicht allein auf das Management des Verstands setzen, sondern auch die Instinkte der Mitarbeiter gezielt nutzen. So lassen sich mit vergleichsweise einfachen Mitteln die Innovationskraft und die Attraktivität als Arbeitgeber steigern. Grenzen und Risiken Viele Nudges scheinen gut zu funktionieren. Es ist allerdings schwer, ihre Langzeitwirkungen einzuschätzen. Zudem beschränken sie sich auf konkrete, klar definierbare Verhaltensweisen und können daher größere Veränderung nur unterstützen. Sie sind kein Ersatz für die traditionellen Instrumente des Change-Managements. Wenn Organisationen den Menschen systematisch Entscheidungen abnehmen oder in eine bestimmte Richtung hin «erleichtern», kann eine auf Eigenverantwortung basierende Entscheidungsroutine nur schlecht gedeihen. Die eigene Bewertung der Welt und ihrer Sachverhalte erfordert Mut. Systemkonforme Mitarbeiter, die ihre Vorgaben brav erfüllen, gelten traditionell auch als die Besten, denn ein Abweichen von der Norm ist hier schlicht ein Fehler. Die Abweichung von der Norm ist allerdings der Schlüssel zu Innovation und Verbesserung. Nudging lebt von Einseitigkeit, nicht vom Dialog. Zugrundeliegende Neigungen und Verzerrungen werden nicht adressiert und Nudges müssen dauerhaft aufrechterhalten werden. Kritischer wird die Lage im Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Mit Big-Data-Ansätzen und intelligenten Maschinen lässt sich Nudging auf eine neue Stufe heben – Big Nudging ist das Stichwort. Für die Beeinflussung des Menschen durch den Computer hat B.J. Fogg, der Pionier in diesem Forschungsgebiet, den Begriff "Captology" geprägt, als Kunstwort, das sich aus dem Ausdruck "computers as persuasive technologies" ableitet. Aufmerksamkeit erzeugen, die Einstellung beeinflussen und vielleicht sogar das Verhalten nachhaltig ändern – das ermöglichen „persuasive Technologien“. Mit personalisierter Information werden Vorschläge unterbreitet. Anwendungen haben oftmals die Aufgabe, etwas beim User zu bewirken, sei es eine Einstellung oder Beurteilung zu ändern oder sie zu einer unmittelbaren Handlung zu bewegen. Wenn man von der Beeinflussung von Menschen durch oder über Computertechnologien spricht, muss man dies auch durch eine ethische Betrachtungsweise näher beleuchten. Die zentrale Frage hierbei ist, ab wann ein Mensch nicht mehr selbstständig beurteilen kann, ob die vom Computer vermittelten Aspekte richtig oder falsch sind. Der Anbieter persuasiver Technologien hat hierbei also auch eine gewisse Verantwortung zu prüfen, ab wann die Kontrolle durch den Menschen verloren gehen kann und die Persuasion gänzlich von der Technologie bzw. derer Eigenschaften bestimmt wird. Ethisch unbedenklich sind dabei Situationen, in denen die Initiative zur Nutzung und Persuasion vom User ausgeht, dieser also gezielt zu etwas bestimmtem "überredet" werden will. Ein gutes Beispiel sind Anwendungen, die in Interaktion mit Home-Fitnessgeräten des Users z.B. dessen Kalorienverbrennungswerte während einer sportlichen Übung ermitteln können und ihn so motivieren, weiterzumachen. Der User ist sich hier über Wirkung und Nutzen der Persuasion im Klaren und nutzt das Angebot gerade deswegen, sodass daran ethisch nichts Verwerfliches zu erkennen ist. Von einer Grauzone spricht man dagegen, wenn die Persuasion vom Nutzer nicht gewollt ist. Hier ist von entscheidender Bedeutung, welche Absichten auf der "Angebotsseite" dahinterstehen. Von unethischem Verhalten spricht man in vielen Fällen, in denen die User über irgendetwas getäuscht werden. Eine klare Abgrenzung zwischen ethischem und unethischem Einsatz von Nudging ist schwer zu finden und sehr umstritten. Notwendig ist aber eine kritische ethische Betrachtung des Persuasive Computing bei dem handelnden Menschen keine selbständige Beurteilung der Korrektheit einer ihm vom Computer vorgeschlagenen Handlungsanweisung mehr möglich ist. Problematisch ist der Übergang, ab wann und über welche Mechanismen der Computer sich hierbei verselbständigt und zum Herrscher über den Menschen wird. „Du kannst jemanden ändern, wenn Du ihn akzeptierst“ (Laotse) Der Grat zwischen Nudging und Manipulation ist schmal und der Einsatz von Nudges laut Thaler von drei Grundsätzen geleitet werden.
Nudges können und dürfen nur dazu dienen, den einen oder anderen Schritt zu erleichtern. Weniger ist hier jedenfalls mehr. Nudges müssen daher sorgfältig ausgewählt und gestaltet, die Zielgruppen beteiligt und der relevante Kontexts berücksichtigt werden. Das führt dazu, dass sich die Mensch gerne „anstupsen“ lassen. „Was bedeutet digitale Transformation für uns?“ An dieser Frage kommt kein Unternehmen vorbei. Die bestehende Geschäftslogik wird in fast allen Branchen von disruptiven Technologien infrage gestellt.
Die exponentielle Geschwindigkeit, mit der sich die Verarbeitung, Speicherung und Kommunikation von Daten entwickelt, kann mit unserem linearen Denken kaum erfasst werden. Haben wir z.B. gerade erfolgreich begonnen, mit Kunden über das Internet und mobile Geräte erfolgreich in Kontakt zu treten ermöglicht Datenintelligenz mittlerweile besseres, schnelleres und effizienteres Wachstum über den Aufbau von personalisierten Kundenerfahrungen. Digitale Transformation ist mehr als Digitalisierung. Sie ist eine kundenfokussierte, strategische Geschäftstransformation. Digitale Transformation beinhaltet eine Reihe von Digitalisierungs-Projekten, das heißt die Umwandlung von anlogen zu digitalen Medien. Häufig ist diese mit Automatisation verbunden. Es ist allerdings ein strategischer Fehler zu glauben, dass es nur um die erfolgreiche Implementierung von digitalen Projekten geht. Die rasende Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung führt zu einer radikalen Senkung von Transaktionskosten, die zur Dekonstruktion von traditionellen Wertketten und folglich zur Bedrohung für vertikal integrierte Geschäftsmodelle wird. Die Wettbewerbslandschaft verändert sich dramatisch. Daher ist es erfolgsentscheidend die Veränderungsfähigkeit der Organisation zu einer Kernkompetenz zu entwickeln und sich durchgehend kundenzentriert auszurichten. Dies erfordert die Fähigkeit einzuschätzen, wie digitale Technologien das Geschäft beeinflussen können und sich schnell an Veränderungen anzupassen. Digitale Transformation bezeichnet folglich einen Prozess, bei der eine Organisation ihr Geschäftsmodell, ihre Prozesse und ihre Kultur unter Einsatz digitaler Technologien verändert, um sich an laufend verändernde Kundenerwartungen anzupassen. Kunden haben durch ihre Erfahrungen mit Amazon, Netflix und Co. immer anspruchsvollere Erwartungen an eine personalisierten und relevante Ansprache und sind damit ein wesentlicher Treiber der digitalen Transformation. Das Kundenerlebnis wird wichtiger. Kunden wird der Wechsel zur Konkurrenz leichter gemacht. Vergleichsportale gibt es viele und das Netz ist voll von Produktrezensionen zufriedener und unzufriedener Kunden. Mehr Touchpoints, mehr Vergleichsmöglichkeiten und mehr Raum für positive wie negative Kritik stellen Unternehmen vor neue Herausforderungen. Digitale Transformation beginnt nicht mit der Auswahl der ansprechendsten Technologie, sondern mit einer wohlüberlegten Entscheidung, wozu, in welchem Feld und in welchem Ausmaß diese zum Einsatz kommen sollen. Wertsteigerung kommt nicht von Technologien allein, sondern von einer neuen Art das Geschäft zu betreiben. Bei E-Commerce geht es nicht um das Internet, sondern darum anders zu verkaufen. Bei Analytics geht es nicht um Datenbanken und Algorithmen, sondern darum, den Kunden besser zu verstehen. Statt lediglich neue Technologien zu implementieren, geht es bei digitaler Transformation um die Weiterentwicklung der Unternehmensprozesse, des Kundenerlebnisses und der Geschäftsmodelle. Mit dem Einsatz von Technik wird die Performance oder die Reichweite von Unternehmen und Organisationen markant erhöht. Digitale Transformation impliziert tiefgreifende Veränderungen auf welche die meisten Organisationen nicht vorbereitet sind. Der Fokus auf Geschwindigkeit verändert alles und zu den wichtigsten organisatorischen Fähigkeiten gehört die Antizipation neuer Chancen und eine entsprechende Wendigkeit. Große Organisationen mit langer Tradition kämpfen mit
Diese Probleme waren schon ohne die Bedrohung durch neue Wettbewerber hinderlich für den Erfolg, wurden aber als Folge der Größe und Komplexität von Konzernen „in Kauf“ genommen. Die neuen Technologien ermöglichen es jetzt neuen Wettbewerbern von unerwarteter Seite anzugreifen und mit rasender Geschwindigkeit das Geschäft zu übernehmen. Der größte Engpass für die bestehenden Unternehmen sind nicht die Technologien, sondern kulturelle Barrieren. Die drei größten Hemmfaktoren sind
Um die neuen technologischen Möglichkeiten optimal zu nutzen brauchen Organisationen eine Kultur, die Engagement und schnelle Entwicklung fördert. Das bedeutet für Führung Abgabe von Macht, weniger Kontrolle und mehr Moderation bzw. Coaching, Hindernisse zu beseitigen, Offenheit und Kommunikation zu fördern. Eine Voraussetzung ist die Entwicklung einer Digitalen Transformationsstrategie. Eine digitale Transformationsstrategie strebt die Möglichkeiten neuer Technologien bestmöglich auszuschöpfen, um
Mehr Eigenverantwortung können Mitarbeiter nur dann erfolgreich wahrnehmen, wenn sie Orientierung über eine klare Aussage zum Sinn und Zukunftsbild der digitalen Transformation bekommen. Sie benötigen Zugang zu allen relevanten Informationen. Informationsverteilung wird organischer und löst sich weitgehend von hierarchischen Filtern. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist interne Experten zu nutzen, die wissen was in ihrem Alltag funktioniert statt externer, die dazu tendieren eine „one-size-fits-all“ Lösung unter dem Titel Best Practice anzubieten. Wie bei jeder Veränderung sind Sorgen und Bedenken im Spiel nicht mitzukommen oder ersetzt zu werden. Daher brauchen Führungskräfte Empathie und die Fähigkeit ihre Mitarbeiter zu coachen und zu inspirieren. Dies gelingt nicht allein über Zahlen und Fakten, sondern über die Fähigkeit Geschichten zu erzählen und kraftvolle Bilder zu entwerfen, die Herz und Hirn ansprechen. Vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen gehört ebenso zu einer der Schlüsselkompetenzen. Sie ist eine Voraussetzung für Kooperation und Partnerschaften, eine der wesentlichen Elemente einer digitalen Kultur. Der Aufbau und die Pflege von Beziehungen, fluide Rollen und Verantwortungen erfordern eine andere Haltung, als jene die in von „Silos“ geprägten Organisationen herrscht. Das heißt, die Mitarbeiter verstehen welche Vorteile die digitale Transformation ihren Kunden und ihnen selbst bringen kann und welche Kompetenzen sie auf- oder ausbauen sollen. Die Kultur ist geprägt von Kreativität und der Fähigkeit anders zu denken. Höchste Priorität hat dabei die Entwicklung einer außergewöhnlichen, hochrelevanten Kundenerfahrung. Die Kultur fördert den Fokus auf Kundenerfahrungen und weniger auf einzelne Produkte und Services. Das erfordert ein Vorgehen von „außen nach innen“ mit einem ausführlichen und tiefgreifenden Kundenverständnis. Technologie ermöglicht, das Geschäft anders zu betreiben. Es ist allerdings eine gute Strategie, die dafür sorgt die richtige Technologie bei den richtigen Aufgaben einzusetzen und die Entwicklung einer passenden Kultur, die ermöglicht, das erfolgreiche Geschäft von morgen zu betreiben. Auch, wenn Veränderungen in den meisten Organisationen zum Tagesgeschäft gehören gelingt tiefergehender Wandel selten. „Das Weiche siegt über das Harte“ heißt es im Dao De Jing. Das gilt auch für Organisationen. Mindestens genauso wie ihre Strategie entscheidet die Kultur über deren Zukunftsfähigkeit.
Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass neben technologischen und strukturellen Veränderungen vor allem die Anpassung der Kultur erfolgsentscheidend ist. „Wir brauchen einen anderen Umgang mit Fehlern. Wir müssen Eigenverantwortung und Agilität fördern. Wir wollen bereichsübergreifende Zusammenarbeit“ – so oder ähnlich lauten die Ambitionen. Es werden Projekte oder Programme gestartet. Führungskräfte erarbeiten eine Vorstellung von der Zielkultur. Mit sorgfältig geplanter und oft auch kreativer Kommunikation werden die Mitarbeiter über verschiedene Kanäle „eingebunden“. So soll das Verständnis für die neue Kultur gefördert und konkrete Ideen zur Umsetzung generiert werden. Die Mitarbeiter stimmen dem zu, finden die Ansätze „ganz gut“, nur um in ihrem Alltag wieder auf eine ganz andere „Realität“ zu stoßen. Als Ergebnis erhält die Organisation eine „buntere Fassade“, ohne dass sich in der tatsächlichen Zusammenarbeit etwas geändert hat. Oft ist die Wirkung dieser Vorhaben bescheiden. Manchmal schaden solche Initiativen sogar mehr als sie nutzen. Woran liegt es, dass viele ambitionierte Transformationsprogramme scheitern? 1. Unklares oder falsches Verständnis von Kultur „Kultur ist die Art, wie wir hier Dinge machen“-in der Regel versteht man unter Kultur von einer Gruppe geteilte Werte und Normen. Sie ist das Ergebnis von gemeinsamen Erfahrungen und bildet sich als Reaktion auf ihre Umwelt heraus. In Organisationen bilden formale Strukturen und Prozesse den Rahmen. Ähnlich wie unser Lebensstil mit der Zeit unsere persönliche Erscheinung prägt und nur mit Lebensstiländerung eine messbare Veränderung herbeigeführt werden kann, verhält es sich auch mit Organisationskulturen. Wenn neue Erfahrungen gemacht werden, die sich besser als die alten herausstellen, ändern sich Einstellungen und Werte. Beschränkt sich Kulturentwicklung auf die Definition und Kommunikation von neuen Werten erhält sie ähnliche Effekte, wie sie die Kosmetikindustrie erzielt. Es entsteht eine hübsche, neue Fassade. Besser als auf abstrakter Werteebene ist es, das konkrete Verhalten durch teilnehmende Beobachtung zu verstehen und daraus abzuleiten, welche kulturellen Änderungen zielführend wären. Als Katalysator sind Anpassungen auf der formalen Seite, nämlich Strukturen und Prozesse erforderlich. Sie setzen den Rahmen, in dem neue Erfahrungen und in der Folge neue Überzeugungen gebildet werden können. Ein guter Ansatzpunkt kann z.B. die Neugestaltung von Meetings sein. Die Veränderung der Dauer, des Teilnehmerkreises, des Rahmens oder der Art der Entscheidungsfindung können über eine Verbesserung der Dialogqualität eine neue Kultur erlebbar machen. 2. Zuviel auf einmal Die Ambitionen sind oft groß, wenn es um Kulturentwicklung geht. Die Liste der gewünschten neuen Verhaltensweisen ist lang und gleicht Neujahrsvorätzen. Folglich sind ihre Erfolgschancen ähnlich. Das liegt unter anderem an unserem Gehirn. Es laufen zwei unterschiedliche Arten von Prozessen parallel ab. Bottom-Up-Prozesse besitzen eine „große Rechenleistung“ und arbeiten beständig alle Aufgaben ab, ohne jedoch unser Bewusstsein zu erreichen. Sie sind schneller als Top-Down-Prozesse, eben weil sie keinerlei Aufmerksamkeit benötigen und so wichtige, täglich anfallende Routineaufgaben erledigen. Die im präfrontalen Cortex stattfindenden Top-Down-Prozesse hingegen erfordern ein bewusstes Agieren unsererseits und ein hohes Maß an Konzentration. Sie sind für das Gehirn anstrengender, verbrauchen mehr Energie und sind zudem deutlich langsamer als Bottom-Up-Prozesse. Unser Gehirn ist nun ein Energiesparer und versucht, aus allen erdenklichen Tätigkeiten Routineabläufe zu erstellen, die dann schnell und effizient als Bottom-Up-Prozess durchgeführt werden können. Nur so gelingt es beispielsweise Hochleistungssportlern, ihre fantastischen Leistungen zu vollbringen, ohne darüber nachzudenken. Die Bewegungsabläufe werden durch beständiges Wiederholen bei höchster Konzentration in die schnelleren Bottom-Up-Prozesse umgewandelt. Problematisch wird es dann, wenn man versucht, eine Verhaltensänderung zu bewirken. Denn hier erweist sich der beschriebene Gehirnprozess als hinderlich. Die Mitarbeiter haben die neu zu lernende Tätigkeit durchaus verstanden und können sie auch korrekt durchführen, wenn sie sich darauf konzentrieren. Sobald die Aufmerksamkeit nachlässt, beendet das Gehirn den anstrengenden Top-Down-Prozess und fällt zurück in den routinemäßigen, bereits gespeicherten Bottom-Up-Prozess). Hinzu kommt, dass neu zu erlernende Tätigkeiten auch nicht immer sofort gelingen, das heißt die Umstellung bei der Verhaltensänderung bringt zusätzliche Frustration mit sich. Der Schlüssel liegt folglich darin, sich auf Weniges und Wesentliches zu konzentrieren. Im Idealfall ist es eine Verhaltensänderung mit dem vermutlich größten Effekt. Die Erfahrung zeigt, wenn man eine Änderung erfolgreich gemeistert hat, andere natürlich folgen. Wichtig dabei ist die Übersetzung in konkrete, machbare Schritte, die einfach im Alltag verfolgt werden können und sich als Lösung für praktische Probleme erweisen. 3. Irrtümer zur Kulturentwicklung Eine weitere Fehlannahme ist, dass Kulturentwicklung vom Topmanagement aus geht. Das ist verständlich, weil Gründer Organisationskulturen maßgeblich prägen. Gründer unterscheiden sich allerdings von Managern. In großen Organisationen haben die Wenigsten direkten Kontakt zum Topmanagement. Und während von der gewünschten Kultur abweichendes Verhalten durch das Topmanagement sehr wohl irritiert, ist ihre sonstige Wirkung auf die Organisation meist geringer, als sie glauben. Das liegt häufig am mangelnden Verständnis der wesentlichen Kulturentwicklungsmechanismen. Frequenz und Prestige sind nach Untersuchungen von Boys und Richardson die wesentlichen Determinanten erfolgreicher Kulturentwicklung. Wir eifern Menschen mit hohem Prestige nach und tendieren dazu kulturelle Merkmale nach ihrer Verbreitung zu bewerten. Prestige und Macht sind dabei nicht gleichzusetzen. Immer wieder hat das Top-Management die Macht aber nicht das Prestige. Es ist auch nicht von Erfolg gekrönt Verhaltensweisen zu pushen, die in einer Organisation (-seinheit) nicht weit verbreitet sind. Vielleicht ist dies der größte Fehler, wenn es um die Implementierung von Kulturveränderungsprogrammen geht. Um erfolgreich zu sein, müsste man „künstlich“ eine Situation schaffen, in der die neue Kultur die dominante ist. Das kann nur mit künstlichen Barrieren gelingen. Kultureller Wandel ist wahrscheinlicher, wenn man sich auf kleinere Einheiten konzentriert. Wie gelingt tief greifende Veränderung in großen Organisationen? Die Antwort liegt darin, wie es gelingt Grenzen zwischen der neuen und der alten Kultur zu etablieren und zu managen. Wobei, in großen Organisationen nicht eine Kultur besteht, sondern viele Subkulturen. Beschleunigt kann die Transformation werden, wenn die bestehenden Kulturzonen markiert werden und man mit einem Piloten in jeder Zone beginnt. Die Piloten müssen zu Beginn vor der alten Kultur geschützt werden und die Gelegenheit haben, zu beweisen, dass sie die besseren Ergebnisse erzielen. Es gibt also nur einige Gründe, warum Transformationen scheitern. Zumeist hat dies mit mangelndem Verständnis für die Zusammenhänge und Dynamiken zu tun. Manchmal ist allerdings tatsächlich nur ein Aufputz nach außen gewünscht. Dann sollte allerdings intern auch Klarheit darüber herrschen, dass es sich nur um eine Marketingmaßnahme handelt. Was meinen Sie dazu? „Meine Erfahrung entsteht daraus, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke“ schrieb schon 1890 William James in „Prinziples of Psychology“.
„Das erste, was ich morgens bei meiner Frau sehe, ist ihr Blick ins Smartphone. Das Gleiche gilt abends vor dem Bett gehen“ so mein Schwiegervater, Ende achtzig über seine Frau in den Siebzigern. Niemand scheint sich der Sogwirkung der Technologien entziehen zu können, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Jung und alt sind infiziert von der Möglichkeit jederzeit an eine Unzahl von Informationen zu kommen und mit jedem in Kontakt zutreten. Was unser Leben vorerst ungemein erleichtert hat, scheint sich jetzt in ein größeres Problem zu verwandeln. Schon vor dem Erscheinen der Smartphones klagten die Menschen über die auf sie hereinbrechende Email Flut, die ihnen wertvolle produktive Zeit stiehlt. Jetzt haben wir unser Device jederzeit dabei und zugänglich. Achtzig Mal täglich öffnen Benutzer im Schnitt ihr Mobiltelefon. Das bestätigt zum Beispiel Apple. Das sind wir: Augen glasig, Mund offen, Hals schief, in Dopamin- und Filterblasen gefangen. Unsere Aufmerksamkeit wird zusammen mit unseren Daten an Werbetreibende verkauft und uns zerstückelt zurückgegeben. Das senkt nicht nur die Produktivität. Es führt auch zu Stress und zu zunehmendem Unbehagen. Facebook und Instagram haben reagiert und stellen neue Werkzeuge vor, um die Zeit auf ihren Plattformen zu beschränken. Aber warum? Die Unternehmen scheinen zu vermuten, dass die viele Zeit im Internet keine wünschenswerte, gesunde Gewohnheit ist, sondern ein lustvolles Laster: eines, das unkontrolliert in eine Sucht abgleiten kann. Sie sind damit ein Teil der „time well spent“ Bewegung, die den Menschen helfen soll ihre Smartphone Sucht zu bekämpfen. "Die Befreiung der menschlichen Aufmerksamkeit kann der entscheidende moralische und politische Kampf unserer Zeit sein", schreibt James Williams, ein Technologe, der zum Philosophen und Autor eines neuen Buches "Stand Out Of Our Light" geworden ist. Herr Williams vergleicht das aktuelle Design unserer Technologie mit "einer ganzen Armee von Jets und Panzern", die darauf abzielen, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen und zu behalten. Und die Armee gewinnt. Wir verbringen den Tag mit unseren Bildschirmen, zucken mit den Daumen in den U-Bahnen, Aufzügen und beim Warten an Ampeln etc.. Um produktiv zu sein und Stress besser zu bewältigen, müssen wir daher unsere Fähigkeiten im Aufmerksamkeitsmanagement stärken. Aufmerksamkeitsmanagement ist die Praxis, Ablenkungen zu kontrollieren, präsent und im Fluss zu sein, und den Fokus zu maximieren. Es geht darum, aktiv statt reaktiv zu sein. Es ist die Fähigkeit zu erkennen, wenn ihre Aufmerksamkeit gestohlen wird (oder das Potenzial hat, gestohlen zu werden) und sich stattdessen auf die Aktivitäten konzentriert, die sie wählen. Anstatt zuzulassen, dass Ablenkungen sich ihrer bemächtigen, wählen sie, zu welchem Zeitpunkt Sie ihre Aufmerksamkeit gemäß Prioritäten und Ziele worauf lenken. Folgende Tipps können dabei helfen:
Das Ergebnis ist die Fähigkeit, ein Leben der Wahl zu schaffen. Es ist mehr als nur Konzentration. Es geht darum, die Kontrolle über Ihre Zeit und Prioritäten zu übernehmen. Denn, wenn Ihre Aufmerksamkeit weiterhin abgelenkt wird und E-Mails, Meetings und "Feuerlöschaktionen" Ihre Tage prägen, werden bald Wochen oder Monate vergangen sein und Ihr Leben wird voll von den "Erfahrungen", die Sie nie wirklich haben wollten. |
Kategorien
Alle
|